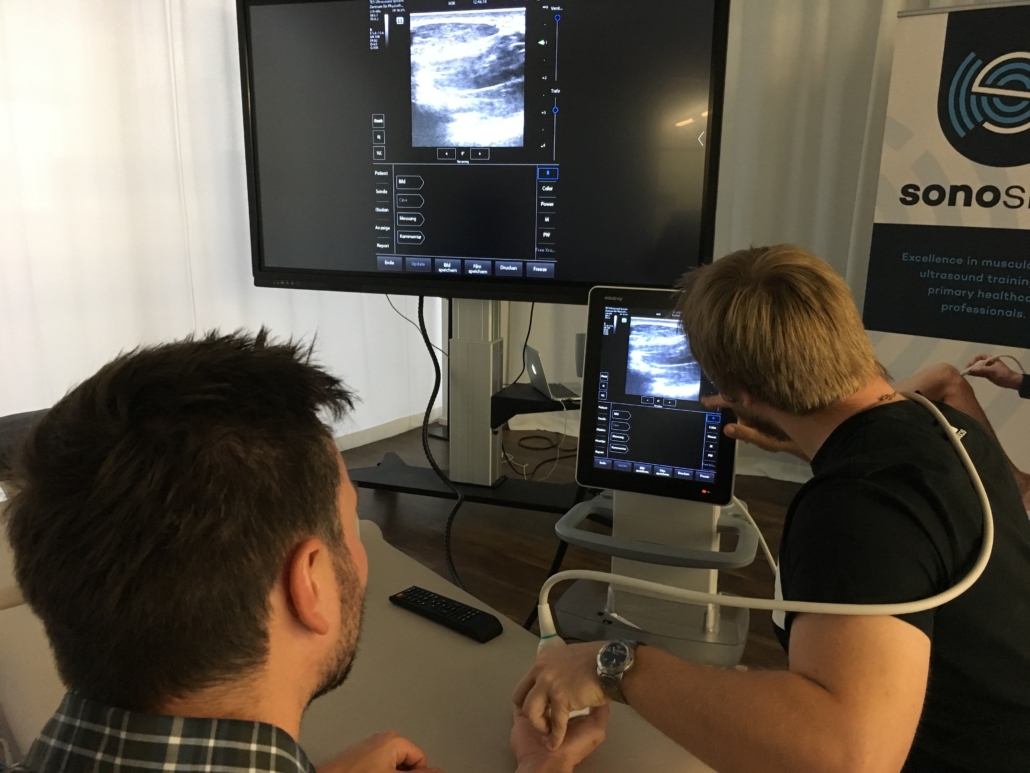FUNCTIONAL NEUROCEPTIVE TECHNIQUE
WAS IST FUNCTIONAL NEUROCEPTIVE TECHNIQUE (NFT)?
FNT kombiniert einfach gesagt spezifische manuelle Behandlungen mit neurologischen Tests und dem aktuellen Wissen aus dem Bereich der Neurowissenschaften (Plastizität; Motorisches Lernen).
Die FNT ist eine dreiteilige Behandlungsmethode:
1. Es gibt die neurologische Diagnostik (NEURO-CHALLANGE), bei der unsere Therapeutinnen den neurologischen Status der ponto-medullären Formatio Reticularis, die 12 Hirnnerven, die persistierenden primitiven Reflexe bis hin zu Funktion des Kleinhirns-/Vestibulums- und dem Frontallappen schnell und exakt erheben.
2. Der zweite Teil beinhaltet die MANUAL-MEDIZINISCHE-BEHANDLUNG, bei der unsere TherapeutInnen alle Rezeptoren im Körper ansprechen, indem Sie u.a. langsame Pumptechniken für die Schädelknochen und die Dura Mater anwenden oder schnelle Dehnungen an den Gelenken/Muskelspindeln als Manipulationen applizieren. Der Mensch ist und bleibt ein rezeptorgesteuertes Wesen und das nützen wir aus.
3. Und da ist noch der letzte Teil der NEUROREHABILITATION und die Prinzipien des motorischen Lernens. Durch Heimübungen über eine längere Zeit (4-8 Wochen) wird die Plastizität unseres Gehirns positiv beeinflusst. Somit ist dieser letzte Teil match-entscheidend. Unsere TherapeutInnen zeigen unseren Patienten mit einer einer Frontallappendysfunktion wie sie anhand neurorehabilitativen Heimübungen wie Sakkadenübungen, Stroop-Test, Gedächtnis- & Inhibitionsübungen erfolgreich rehabilitieren. Im Weiteren unsere Patienten mit einer funktionellen visuellen Dysfunktion (Sehstörungen) anhand von optokinetischen Übungen, Aufgaben zur Unterdrückung des okkulär-visuellen Reflexes (VOR) die Augendysfunktion trainiert und verbessert. Für die Optimierung des Gleichgewicht-Systems werden diverse zerebellär-vestibuläre Übungen instruiert.
WAS BEDEUTED EIGENTLICH DAS WORT NEUROZEPTION?
Neurozeption bedeutet unbewusstes Wahrnehmen. Der Begriff wurde vom amerikanischen Wissenschaftler und Professor für Psychiatrie Stephen W. Porges geprägt. Neurozeption ist ein Vorgang, bei dem unser Nervensystem sämtliche Informationen aus der Umgebung aber auch aus dem Körperinneren, aufnimmt, sie verarbeitet und in primitiven Hirnarealen anhand dieser Daten eine Einschätzung vornimmt, ob die Umgebung sicher ist, bedrohlich oder lebensgefährlich. Durch multifaktoriell-beigeführte orthopädische oder neurologische Traumata kann die Neurozeption beeinträchtigt werden, wie beispielsweise Folgen von kleineren und schwereren Schädelhirntraumen.
Schädelhirntraumen (SHT) ist definiert als jedes Trauma des Gehirns nach der Geburt. Dazu gehören auch Schlaganfälle und alle Arten von traumatischen Hirnverletzungen. Sogar leichte Beulen am Kopf können schließlich zu anhaltenden post-konkussiven Symptomen führen, die sich meistens mit der Zeit verschlimmern (growing into deficits).
SHT-Symptome sind zahlreich und diffus, was die Diagnose oft erschwert. Häufige Beschwerden sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Benommenheit, Gehirnnebel, Gedächtnis- und Konzentrationsverlust, Stimmungsschwankungen, Orientierungslosigkeit, Depression, Angst, Schlaflosigkeit, Sprachschwierigkeiten, Gleichgewichtsverlust, Schwindel, verschwommenes Sehen, Geruchs- und Geschmacksveränderungen, Lichtempfindlichkeit oder Geräusche, Ko-ordinationsverlust, Muskelschwäche und Kribbeln in Armen und Beinen.
Nicht einmal unsere Kinder werden davon verschont. Wie viele Kinder stürzen und stoßen sich den Kopf an, wenn sie versuchen, aus dem Bett zu steigen oder eine Treppe hinunterzustürzen (nicht zu vergessen sind die Wickeltischtraumen). Die Zahlen sind atemberaubend hoch. Plötzliche Veränderungen der Ess- oder Stillgewohnheiten, Reizbarkeit, anhaltendes Weinen, Aufmerksamkeitsdefizite, Schlafstörungen, Stimmungs-schwankungen und sogar Depressionen können alle auf eine Hirnschädigung hinweisen. SHT ist heute als „stille Epidemie“ bekannt und betrifft Schätzungen zufolge jedes Jahr zwischen 27 und 69 Millionen weltweit. Die Zahl der Menschen, die weiterhin leiden und wenig Hoffnung auf eine teilweise Genesung haben, wächst kontinuierlich.
Aber es könnte Hoffnung geben, dass dieses Leiden einer funktionellen neurologischen Störung der Vergangenheit angehört. Durch verschiedenste erworbene Läsion im Gehirn kann es zu einer einseitigen funktionellen Hirnschwäche kommen, welches als Hemisphericity bezeichnet wird.
PSEUDO-PYRAMIDALES INHIBITIONSMUSTER / HEMISPHERICIY
Hemisphericity, oder auch pseudo-pyramidales Inhibtionsmuster (PPIM) genannt, ist der Begriff, den wir in der funktionellen Neurologie verwenden, um Unterschiede in der Feuerrate zwischen der linken und rechten Seite des Gehirns zu beschreiben. Das hemisphärische Modell geht davon aus, dass eine Seite des Gehirns nicht richtig feuert und im Allgemeinen einen anderen zentralen integrativen Zustand hat als die andere Seite. Dies ist normalerweise auf einen physiologischen Prozess zurückzuführen, der eine unterschiedliche Feuerungsrate des afferenten Bombardements beinhaltet, entweder aufgrund eines Gelenkpositionsfehlers (z. B. eines vertebralen Subluxationskomplexes) oder einer anderen neurologischen Läsion.
Wenn ein neurologisches System nicht richtig feuert, wird im Wesentlichen auch sein postsynaptisches neurologisches System nicht richtig feuern. Wenn A nicht auf B feuern kann und B auf C feuert, dann hat C eine verringerte Feuerrate. Wenn wir über das hemisphärische Modell sprechen, liegt es in der Definition, dass es eine leistungsschwächere Großhirnrinde und eine leistungsstärkere Großhirnrinde geben wird.
Ein neuartiges Behandlungsverfahren, die FUNCTIONAL NEUROCEPTIVE TECHNIQUE (NFT), entwickelt von Andreas Philipp Kacsir, MMSc, und Kollegen, könnte dazu beitragen, dass Leiden einer funktionellen neurologischen Störung der Vergangenheit angehören. Die Methode verwendet eine Kombination nicht-invasiver Behandlungen, die sich als äußerst effektiv erwiesen haben, um vielen Patienten mit funktionellen neurologischen Störungen zu helfen, sich zu verbessern oder vollständig zu erholen.
«Die Ergebnisse, die wir mit FNT sehen, übertreffen unsere Vorstellungen, sie sind einfach atemberaubend. Es verändert einfach die Menschen. Und was uns sehr freut, ist, dass dies aus der Applied Kinesiology resultiert. Ihre Grundlage ist Applied Kinesiology. Im Weiteren fliessen die neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und der Neurorehabilitation, der viszeralen Osteopathie, der modernen Chiropraktik und des Fasziendistorsionsmodells (FDM) hinein», erklärt Andreas Philipp Kacsir, Gründer der FNT.
«Wir müssen es einfach allen zugänglich machen!»
Ich freue mich sehr, Sie in die spannende Welt der funktionellen Neurologie entführen zu dürfen! Ihr Andreas Philipp Kacsir, MMSc
DOWNLOADS
OPTOKINETISCHE STIMULATION
Von links nach rechts (für linke Hemisphärenschwäche)
Von rechts nach links (für rechte Hemisphärenschwäche)